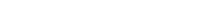Ich hasse die Zeit, denn sie ist eigenwillig. Ihr ist egal, ob man will, dass sie vorbeigeht, dass sie langsamer geht, dass sie schneller geht, dass sie still steht. Rücksichtslos tut sie, was sie will.
Ich hasse diesen endlos langen Moment, wenn der Lehrer mich nach der Antwort fragt und all die Zahnräder meines Gehirns still zu stehen scheinen. Wie ich es hasse, wie die Schüler mich dann anstarren, mir mit ihren giftigen, demütigenden Blicken Löcher in meinen Rücken, in meine Brust, in meinen Bauch, in mein Gesicht bohren. Wie kann man so dumm sein. Ich höre, wie sie es denken. Ich höre es so, als würden sie es direkt in meine Ohren hinein schreien, von allen Seiten, der eine lauter als der andere. Und in meinem Kopf schallen ihre verurteilenden Schreie wider und deren Echos werden endlos lange nachgehallt. Und gerade wenn das Echo zu leise sein scheint, um weiterhin nachgehallt zu werden, schreien sie es mir erneut zu, während sie mich durchbohren, und das Ganze beginnt von vorne.
Ich hasse, wie sie sich in der Pause hinstellen, sodass es scheint, als würden sie mich nicht beobachten, mich aber dauernd im Blickwinkel haben. Ich. Ertrage. Das. Nicht.
Ich ertrage es nicht, im Netz ihrer Blicke gefangen zu sein. Ja, diese Monster spinnen Fäden mit ihren Augen, Fäden, die mich erst umschleiern, bevor sie sich unbemerkt immer enger legen.
Und ich hasse, wie ich mich dann fühle. Ich kann nicht einfach locker sein, wenn ich weiss, dass ich geprüft werde. Ich kann nicht einfach locker sein, wenn ich doch weiss, dass man über mich urteilt. Wie wenn mich die Leute an der Bushaltestelle schon von weitem erblicken. Und auch wenn sie so tun, als würden sie mich nicht beachten, spüre ich, wie sie jede meiner Bewegungen auffangen. Wie sie mich mustern. Ich sehe die Abscheu in ihren Gesichtern. Genauso wie in meinem, dass ich plötzlich gespiegelt im Fenster des Busses sehe.
Ich hasse es, zu Hause zu sein, wo mich niemand empfängt. Wo ich die Tür öffne, alleine in die Küche gehe und den Abwasch mache und mich dabei erwische, wie ich träume. Ich träume, meine Mutter käme, streiche mir durchs Haar und würde sagen, ich soll mich doch zuerst ausruhen. Dabei würde sie lächeln und mich mit ihren sanften Wörtern beruhigen. Die ganze Wut würde sie mit ihrer lieben Stimme ersticken und ich wäre endlich ruhig, da, in mir drin, da wär ich ruhig.
Das mag ich nicht, wenn ich mich beim Träumen erwische. Ich fühle mich dann so hilflos und ich steh einfach da. In der Küche in unserer Wohnung, in diesem scheiss grauen Block in diesem beschissenen Viertel und ich merke wie klein ich bin, und wie unwichtig. Und es ist still, nicht erdrückend, sondern einfach still. Und nichts ist mehr von Belang.
Das mag ich sehr, wenn alles plötzlich egal wird. Das ist wie ein Zustand der vollkommenen Gleichgültigkeit, ich fühl nicht zu viel, ich fühl ausserdem nicht zu wenig. Ich denke nicht nach. Meine Träume werden zu Illusionen der Vergangenheit, die Fremden von der Haltestelle werden zu Schatten, die sich im Rhythmus der sich regelmässig dahintreibenden Zeit bewegen und die Monster, die werden klein. Und ich werde grösser, so, dass ich durchschnittlich bin. Nicht wie sonst, so klein und so unauffällig, dass meine Unscheinbarkeit gleich wieder in jedermanns Auge sticht.
Heute jedoch ist kein Tag der Gelassenheit. Auch kein Tag der Wut, oder der Träumerei. Ich sitze in meinem Zimmer und ich starre hinaus, oder auch nicht, denn ich nehme nicht wahr, was sich draussen befindet. Und ich weiss nicht, was mich stört. Wo ich es doch sonst zu schätzen weiss, wenn ich nicht draussen sein muss. Dort, wo mich niemand direkt ansieht, mich aber jeder unauffällig anstarrt. Und dort, wo ich niemanden anzuschauen wage.
Wieso fühl ich mich also schon seit Stunden nicht wohl hier drin?
Will ich mehr? Will ich mehr wie die Stille und das Alleinsein?
Ich will endlich aus der Türe gehen und sein, mir keinen Kopf daraus machen, dass mich die anderen anstarren oder schlecht über mich denken könnten. Ich will nicht mehr nur den Boden und meine Schuhe sehen, wenn ich auf der Strasse laufe. Verdammt nochmal, das will ich nicht.
Ich will endlich vor der Klasse stehen und sorgenlos ein Referat halten können, und antworten, wenn mich der Lehrer was fragt, das wäre sehr schön. Im Sportunterricht will ich mich frei bewegen können. In den Pausen will ich mich zu den anderen setzen. Ich will keine Schatten, ich will die Menschen sehen. Ich weiss jetzt zwar nicht, ob ich mir viel wünsche, aber ich will das alles, ich will es mir holen.
… das Ende der Geschichte kannst Du im Bleiwiis-Buch 2013 nachlesen.